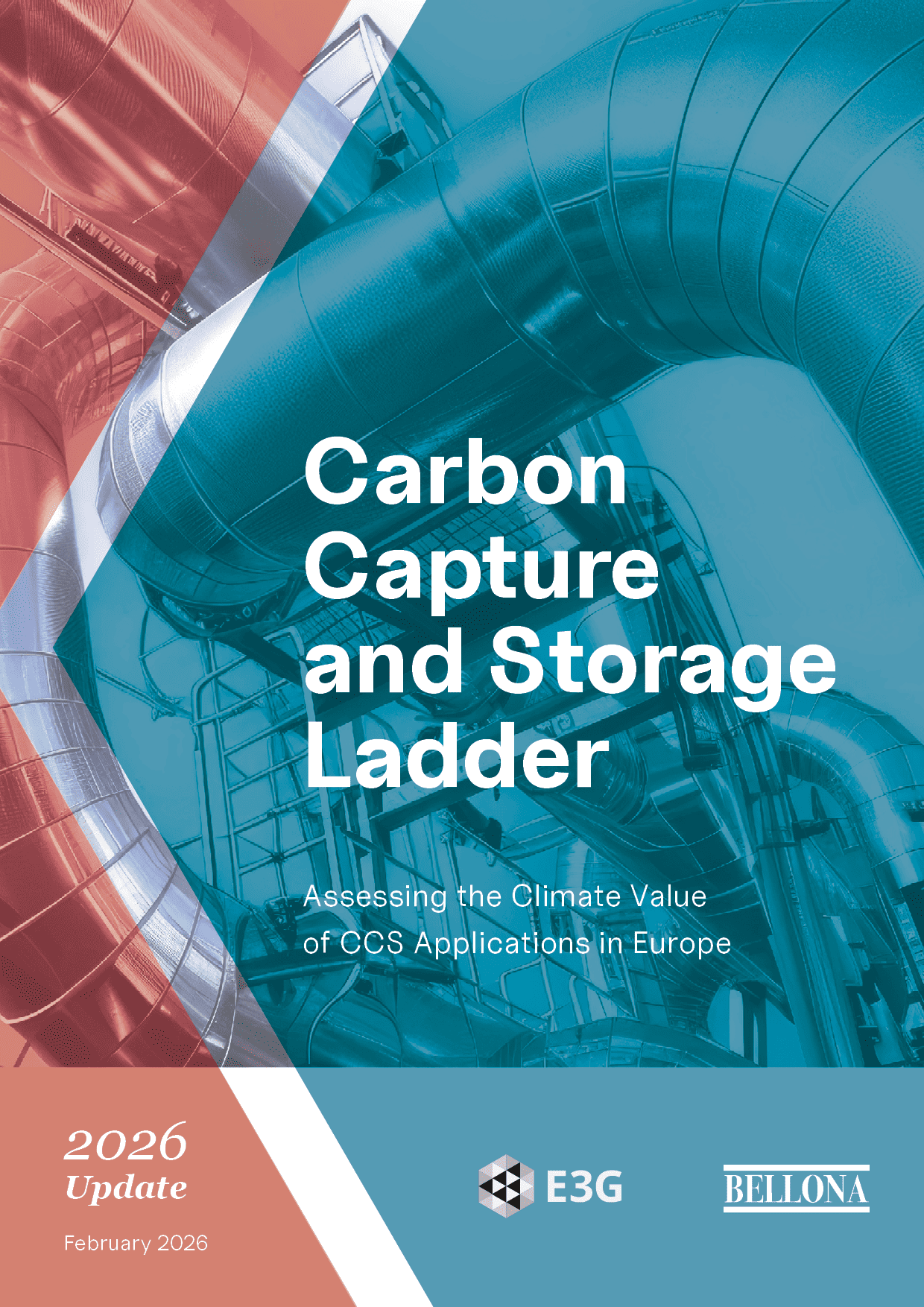Bellona Deutschland hat im Rahmen der Verbändeanhörung zur Ratifizierung der Änderung von Artikel 6 des Londoner Protokolls sowie zum ersten Gesetz zur Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes (HSEG) eine Stellungnahme abgegeben.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass mit dem geänderten HSEG ein nationales Ausführungsgesetz vorgelegt wurde, das die internationalen Verpflichtungen aus dem Londoner Protokoll umsetzt und den Schutz der Meeresumwelt in den Mittelpunkt stellt. Damit werden Rechtsklarheit und einheitliche Maßstäbe für Einbringungsvorgänge auf Hoher See geschaffen. Zugleich bildet das HSEG eine wichtige Grundlage für den Aufbau von CO₂-Speichern in der deutschen Nordsee (AWZ) sowie für die Erforschung mariner Ansätze zur CO₂-Entnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR).
Elemente der Stellungnahme:
- Ermöglichung der tiefengeologischen CO2-Speicherung in der deutschen AWZ: CCS (Carbon Capture and Storage) ist ein benötigter Baustein zur Dekarbonisierung von Industrien mit schwer vermeidbaren Emissionen. Neben dem Fokus auf ambitionierter Emissionsvermeidung braucht es den parallelen Aufbau skalierbarer CO₂-Reduktions- und Entnahmeoptionen. Die Ermöglichung des Aufbaus von CO2-Speichern offshore ist ein Schlüsselelement zum Hochlauf von CCS in Deutschland.
- Naturschutz und Raumordnung: Strenge Umweltstandards sind für die meeresschutzkonforme Umsetzung der CO2-Speicherung unerlässlich. Dazu gehören Mindestabstände zu Schutzgebieten, der Schutz sensibler Arten wie des Schweinswals, schallminimierende Verfahren bei Standorterkundungen sowie die Wahrung des Vorrangs der Offshore-Windenergie. Dies gilt es nun, strategisch-planerisch in Strategien und auch ganz konkret in Rechtverordnungen zum KSpTG zur Umsetzung zu bringen.
- CO2-Export: Mit der Ratifizierung der Änderung von Artikel 6 des Londoner Protokolls wird der Export von CO₂ rechtlich möglich, doch entbehrt dies nicht von der Verantwortung, direkte bilaterale Kooperation voranzutreiben. Aus Kostengründen, der notwendigen Verantwortungsübernahme für die eigenen Emissionen und nicht zuletzt auch zur Wahrung der Technologiesouveränität darf der CO2-Export jedoch nicht den Ambitionsgrad beim Aufbau eigener Speicher in Deutschland mindern.
- Forschung an marinen CDR-Verfahren: Forschung an marinen CDR-Methoden muss auch in deutschem Hoheitsgebiet ermöglicht, rechtlich jedoch klar von kommerziellen Anwendungen abgegrenzt und international abgestimmt werden. Nur so können Chancen und Risiken seriös bewertet und politische Entscheidungen auf eine solide wissenschaftliche Basis gestellt werden. Dabei muss klar sein, dass wir nicht beliebig viel CO₂ entnehmen können, um alle aktuellen und zukünftigen Emissionen zu adressieren. Methoden zur permanenten CO₂-Entnahme fußen oft auf Technologien, die noch nicht im großen Maßstab existieren, auf absehbare Zeit teuer bleiben und sehr ressourcenintensiv sind. Die sehr unterschiedliche Eingriffsintensität mariner CDR-Verfahren in Ökosysteme legt nahe, trotz der hier aus juristischen Gründen erforderlichen Einführung des Begriffs des Geoengineerings, definitorische klare Abgrenzungen vorzunehmen oder ggf. die erforderlichen Regelungen nicht im HSEG umzusetzen, sondern in ein dezidiertes eigenes Gesetz auszulagern.
Insgesamt sehen wir in den Gesetzesänderungen einen wichtigen Schritt, um Klimaschutz, Meeresschutz und Forschungsfreiheit mit den Erfordernissen des Hochlaufs von CDR und CCS zu verbinden. Entscheidend wird sein, die gesetzlichen Grundlagen durch konkrete Verordnungen und klare strategische Leitlinien (in der Carbon Management-Strategie und der Langfriststrategie Negativemissionen) zu ergänzen – damit CCS und CDR in Deutschland ökologisch verträglich und mit positiver Klimaschutzwirkung umgesetzt werden können.
Ansprechspartner

Fabian Liss
Referent Industrielles Carbon Management

Dr. Georg Kobiela
Politische Leitung